Initiative Mobilitätskultur
Ideenschmiede für die Mobilitätswende
Ziel der Initiative Mobilitätskultur ist es, wirkungsvolle Maßnahmen für die Mobilitätswende zu fördern. Damit das gelingt, müssen die relevanten Themen vor Ort gemeinsam identifiziert werden – mit den Menschen, die sie betreffen.
Bei unserer „Ideenschmiede“ haben wir rund dreißig Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Verwaltung, Politik und Wirtschaft in Leipzig zusammengebracht, Herausforderungen benannt und erste Lösungsansätze für eine sozial gerechte, nachhaltige und alltagsnahe Mobilität entwickelt. Ein besonderer Fokus lag dabei auf ländlichen Räumen in Ostdeutschland.
Mobilitätskultur: Mehr als Verkehr
Die Initiative Mobilitätskultur versteht Mobilität als sozialen Faktor. Es geht um mehr als Strecken, Fahrzeuge und CO₂. Mobilität entscheidet darüber, ob Menschen Begegnungen erleben, Orte erreichen, Kultur genießen und sich in ihrer Region wohlfühlen. Wer mobil ist, kann teilhaben – und wer teilhat, entwickelt Vertrauen in die eigene Gestaltungsfähigkeit, in die Gemeinschaft, in öffentliche Institutionen und in die Zukunft.
Bei der Ideenschmiede haben wir daher auf einen Prozess gesetzt, der Vertrauen schafft und die Perspektiven der Teilnehmenden über Sektorengrenzen hinweg verbindet: Erst tauschten sich die Teilnehmenden über ihre Erfahrungen und Stärken aus, dann sammelten wir die größten Hindernisse für die Mobilitätswende und entwickelten gemeinsam erste Projektansätze.
Was die Mobilitätswende ausbremst
Die Teilnehmenden identifizierten zahlreiche Hindernisse für nachhaltige Mobilität: Strukturelle Hürden wie starre Routinen in Verwaltungen, überlastete Mitarbeitende und fehlende sektorübergreifende Zusammenarbeit erschweren Veränderung. Ressourcenengpässe bei Finanzierung, Personal und Zeit verhindern die Umsetzung guter Ideen. Die Innovationskultur leidet unter Angst vor Fehlern, zu kurzen Projektlaufzeiten und geringem Interesse an neuen Bildungsformaten. Im ländlichen Raum verschärfen große Distanzen, fehlende ÖPNV-Angebote und mangelnde Begegnungsräume die Situation. Hinzu kommt die Alltagsperspektive: Mobilität muss sich gut anfühlen: wer im Bahnhof keinen Kaffee bekommt oder sich im Bus unwohl fühlt, nutzt diese Angebote ungern. Außerdem erschwert die fachliche Komplexität den Zugang: Die Sprache der Mobilität ist oft technisch und abschreckend, es fehlen verständliche Bilder und klare Nutzenversprechen. Und nicht zuletzt hemmt eine weit verbreitete Veränderungsskepsis in der Gesellschaft sowie Misstrauen gegenüber Institutionen viele Prozesse zusätzlich.
Von Problemen zu Projektideen
Nach dem gemeinsamen Blick auf die Hürden begann der spannendste Abschnitt des Tages: die Ideenschmiede. Die Beteiligten entwickelten konkrete Projektideen. Hier einige Beispiele:
Lokaler Mobilitätsbedarf: Kultur und Begegnung ermöglichen
- Bahnhöfe als soziale Treffpunkte: Viele Bahnhöfe sind heute Orte des Durchhetzens oder werden gemieden. Die Idee: Leerstehende Räume nutzen, kleine Gastronomie ansiedeln, saubere Toiletten und sichere Wartebereiche schaffen, lokale Initiativen einbinden. Die Wirkung: Mehr Aufenthaltsqualität, mehr soziale Begegnungen, mehr Lust auf ÖPNV.
- Mobilitätsangebote für Kulturveranstaltungen: Das klassische Problem – man würde gern zum Konzert, kommt aber ohne Auto nicht hin. Die Idee: Mitfahrbörsen, Rufbusse, Carsharing-Flotten, Anreizsysteme (etwa ein Getränk aufs Haus bei Anreise per ÖPNV) und digitale Tools zur Fahrtenvermittlung. Die Wirkung: Mehr kulturelle Teilhabe, weniger Abhängigkeit vom Auto und ein konkretes Erlebnis, dass Mobilität anders funktionieren kann.
Beratung und Qualifizierung: Know-how aufbauen
- Qualifizierungs-Offensive für kleine Kommunen: Viele Gemeinden wollen etwas verändern, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen. Die Idee: Bürgerräte, runde Tische und Beteiligungsformate kombiniert mit Qualifizierung für Verwaltungsmitarbeitende und ehrenamtliche Initiativen. Die Wirkung: Mehr Selbstwirksamkeit, mehr Mut, mehr Umsetzung. Mobilität wird zur Gemeinschaftsaufgabe statt zur Verwaltungsroutine.
- Kommunikationsstrategien für die Mobilitätswende: Der öffentliche Diskurs ist oft verhärtet – Auto gegen Fahrrad, statt: Wie gestalten wir Lebensqualität? Die Idee: Kommunikationstrainings für Politik und Verwaltung, moderierte Bürgerräte, strategische Öffentlichkeitsarbeit, neue Narrative. Die Wirkung: Weniger Abwehr, mehr Verständnis, ein öffentlicher Diskurs, der verbindet statt spaltet.
Demokratiestärkung durch Beteiligung: Mitgestaltung fördern
- Umgang mit Widerständen in der Kommunalpolitik: Viele gute Vorschläge scheitern im Stadtrat. Die Idee: Verkehrsversuche, Exkursionen in erfolgreiche Modellkommunen, kulturelle Formate wie Theater oder Themenspaziergänge, Planspiele und Beteiligungsformate. Die Wirkung: Erfahrungen statt Vorurteile. Politische Entscheidungsträger*innen werden zu Mitgestaltenden, die Umsetzungsbereitschaft steigt.
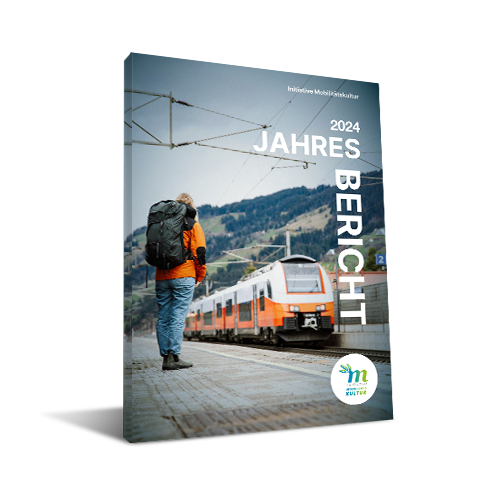
Aktuelle Projekte der Initiative im Fokus
Zwischenfazit und Ausblick
Die Mobilitätswende wird nur gelingen, wenn wir sie als gesellschaftliches Projekt begreifen. Wir brauchen Orte, an denen Menschen gute Erfahrungen mit neuer Mobilität machen, und Prozesse, die mit Menschen statt über sie hinweg arbeiten. Wir brauchen eine Sprache, die positiv motiviert, und Verbündete, die sich gegenseitig stärken. Mobilitätskultur heißt nicht: Wir kämpfen gegen das Auto. Es heißt: Wir gestalten Mobilität so, dass sie zu unseren Leben passt.
Der Prozess unserer Ideenschmiede in Leipzig hat gezeigt: Wenn lokale Akteur*innen von Anfang an eingebunden werden, können Lösungen entstehen, die wirklich greifen. Perspektiven aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ergänzen sich, und Vertrauen in die Zusammenarbeit wächst. Gerade bei komplexen Herausforderungen wie der Mobilitätswende ist diese Multiperspektivität entscheidend.
Beteiligung ist kein „Extra”, sondern die Grundlage für wirkungsvolle Förderung. Besonders deutlich wird das in den ländlichen Räumen Ostdeutschlands, die mit spezifischen Mobilitätsherausforderungen, aber auch großen Gestaltungspotenzialen in den Prozess eingebracht wurden und eine wichtige Rolle für unsere Arbeit spielen.
Die entwickelten Ideen werden wir in digitalen Folgetreffen weiter konkretisieren und zu förderfähigen Projekten ausarbeiten. Alle Beteiligten und alle, die dazu kommen wollen, sind eingeladen, mitzudenken und mitzumachen.
Wenn Sie Fragen haben:
Sonja Schäffler

Gefördert durch:
